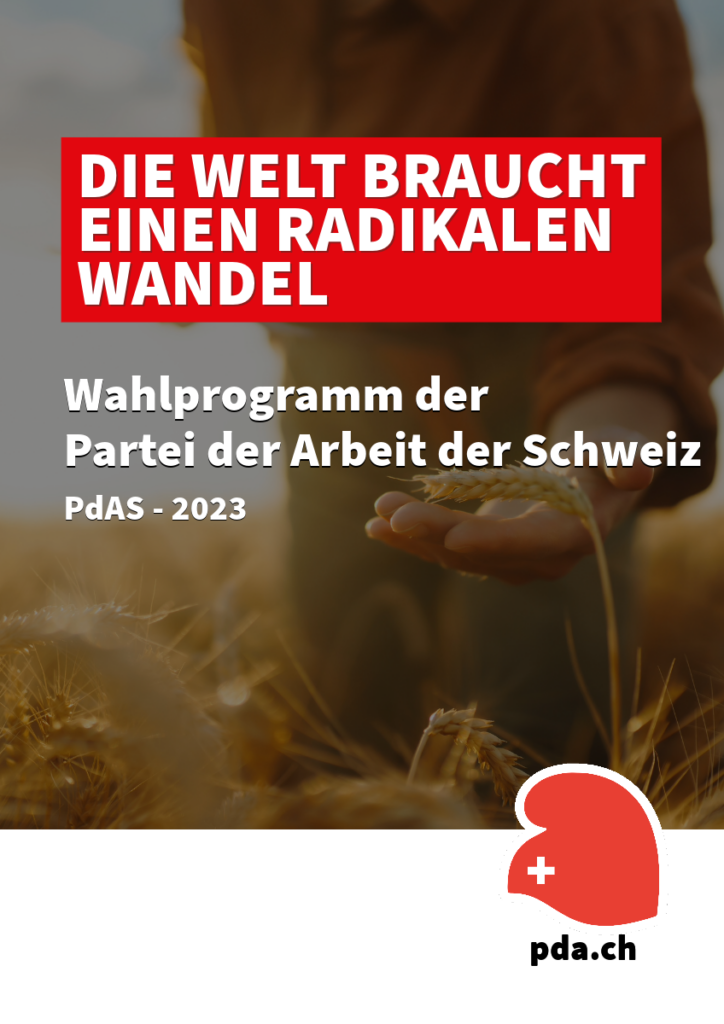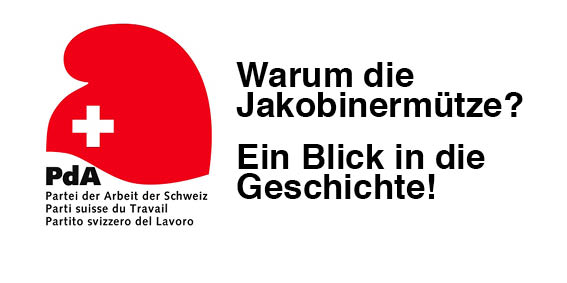Nächste Runde Prämienschock
 Am 23. September machte der Bundesrat publik, dass auch im nächsten Jahr die Krankenkassenprämien steigen werden. Je nach Kanton drohen schmerzhafte Einschnitte – die Versicherungsindustrie wälzt die Kosten auf die Bevölkerung ab. Angesichts der Zustände im Gesundheitswesen ist diese Entwicklung besonders bedenklich.
Am 23. September machte der Bundesrat publik, dass auch im nächsten Jahr die Krankenkassenprämien steigen werden. Je nach Kanton drohen schmerzhafte Einschnitte – die Versicherungsindustrie wälzt die Kosten auf die Bevölkerung ab. Angesichts der Zustände im Gesundheitswesen ist diese Entwicklung besonders bedenklich.
Am 27. September 2023 titelte das SRF online: «Prämienschock 2024 – Berner Familie ‹Wir zahlen so viel Krankenkasse wie Miete›.» Genau ein Jahr später hiess es: «Arena zum Prämienschock – Woran krankt unser Gesundheitssystem?» (Wir haben eine Antwort, dazu später mehr). Und heuer, etwas früher im September, bereits am 23., schrieb das SRF: «Krankenkassenprämien steigen erneut deutlich».
Ein schwacher Trost
Das Einzige, was jedes Jahr neu vermeldet werden muss, ist die Höhe des Anstiegs. Dieser liegt laut SP-Bundesrätin Baume-Schneider, die einen Tag nach dem SRF informierte, mit durchschnittlich 4,4 Prozent zwar tiefer als in den Vorjahren. Ein schwacher Trost – die Löhne stiegen 2024 in der Schweiz durchschnittlich nur um 1,8 Prozent. Ohne einen Spezialfall in Zug würde noch deutlicher, wie stark die Prämienbelastung die meisten trifft. In der Zentralschweizer Steueroase sanken die Prämien im letzten Jahr nämlich um rund 14 bis 15 Prozent. Grund dafür war, dass der Kanton wegen seiner Steuerkonkurrenz einen Überschuss von 200 Millionen «loswerden» musste. Zug übernahm daher 2023 rund 99 Prozent der Krankenhauskosten seiner Bewohner:innen. Das dürfte den landesweiten Anstieg um bis zu 0,3 Prozent gedrückt haben. Zuvor waren jedoch optimistischere Zahlen im Umlauf: Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich hatte Ende Juni in einer Studie von einem gesamtschweizerischen Kostenanstieg von lediglich 2,7 Prozent gesprochen.
An Krankheit verdienen
Als Erklärung für die steigenden Kosten muss wieder einmal die Bevölkerung herhalten. Sie gehe halt häufiger zum Arzt und werde zudem älter. Was in den gängigen Erklärmodellen jedoch kaum vorkommt: die Preispolitik neuer Medikamente, die oft zu abstrusen Wucherpreisen auf den Markt geworfen werden. Medikamente sind mittlerweile der zweitgrösste Kostenblock im Schweizer Gesundheitswesen. Angesichts des Zollstreits mit den USA, bei dem unter Umständen die gesamte Schweizer Bevölkerung für die Profite von Pharmaindustrie und Bankensektor bezahlen muss, kündigte Novartis-Chef Vas Narasimhan gegenüber der NZZ bereits höhere Medikamentenpreise an. In einer Selbstgerechtigkeit, wie man sie von Superreichen kennt, erklärte er, die Medikamentenpreise in der Schweiz seien schlicht zu tief. Narasimhan verdient übrigens selbst 19,2 Millionen Franken – vielleicht hofft er bei teureren Medikamenten auf noch mehr.
Darüber hinaus gilt: Für neue Leistungen wird die Prämie nach oben angepasst. Werden aber Menschen durch neue Technologien oder durch die Aufnahme von Behandlungsmethoden in die Grundversicherung gesünder und verursachen dadurch weniger Kosten, erfolgt keine Reduktion der Prämien. Irgendein nutzloser Bourgeois muss ja an unseren Krankheiten verdienen – es ist ja immer noch Kapitalismus. So wird etwa die Aufnahme von Psychotherapie in die Grundversicherung als Kostentreiber dargestellt, während die grassierende Epidemie psychischer Erkrankungen, die laut Bund Folgekosten von sieben Milliarden Franken verursacht, «vergessen» wird.
Bequemer Irrgarten
Ein weiteres Beispiel sind derzeit Abnehmspritzen, die in manchen Medien
bereits als künftige potenzielle Preistreiberin gehandelt werden. Unerwähnt bleibt dabei, dass der Schweiz jährlich acht Milliarden Franken an Krankheitskosten durch Übergewicht und Adipositas entstehen. Für viele klingt es zunächst plausibel: Neue Behandlungsmethoden in Kombination mit einer Mengenausweitung – eine alternde Bevölkerung nimmt häufiger medizinische Leistungen in Anspruch – führten zu höheren Preisen. Dass jedoch manche Massnahmen – auch wenn sie zunächst Kosten verursachen – andere Ausgaben senken können, wird verschwiegen. So betrugen die Mehrkosten der Krankenkassen durch die neue Abrechnung der Psychotherapie über die Grundversicherung seit 2022 rund 350 Millionen Franken. Rechnen wir konservativ mit den Zahlen des Bundes – eine Studie zu den volkswirtschaftlichen Kosten psychischer Erkrankungen gab für 2010 gar elf Milliarden Franken an – ergibt sich für denselben Zeitraum eine Summe von 21 Milliarden Franken. Mit der sinkenden Kaufkraft dürfte sich die gesundheitliche Situation der Bewohner:innen der Schweiz weiter verschlechtern – aber Hauptsache, Nestlé-Narasimhan verdient daran weiterhin ein zweistelliges Millionengehalt.
Quelle: vorwärts